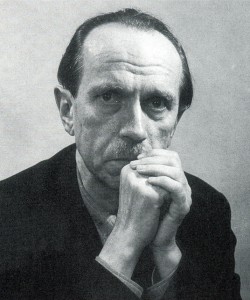Stationen
Geboren 1939 in Rinteln an der Weser. 1959 bis 1965 Studium an der FU Berlin (Publizistik, Germanistik, Theaterwissenschaft, Anglistik). Daneben Volontariat bei der Hannoverschen Presse bzw. bei der Neuen Hannoverschen Presse. 1967 Promotion. 1967 Presse- und Kulturreferentin im United States Information Center in Hannover. 1969 Redakteurin für Politik bei der Neuen Hannoverschen Presse. 1971 zunächst Redakteurin, ab 1972 Abteilungsleiterin in der PR-Abteilung von Coca-Cola Central Europe in Essen. 1973 Redakteurin für Politik bei der Neuen Ruhr Zeitung in Essen. 1974 Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Sektion für Publizistik und Kommunikation an der Ruhr-Universität Bochum, 1975 Akademische Rätin, 1976 Beamtin auf Lebenszeit, 1977 Oberrätin. 1982 Habilitation und C2-Professorin für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Bochum. 1989 C3-Professorin für Theorie und Praxis des Journalismus und der Öffentlichkeitsarbeit an der FU Berlin (bis 2004). 1991 Mitglied der Gründungskommission für einen Fachbereich Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig. 1993 Ruf auf die C4-Professur für Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations in Leipzig (abgelehnt). Verheiratet, keine Kinder.
Könnten Sie zu Beginn etwas über Ihr Elternhaus erzählen, über die Zeit bis zum Studienbeginn?
Rinteln ist eine alte Universitätsstadt, ziemlich klein und übersichtlich, 10.000 Einwohner damals. Der Drucker Lucius hat dort die erste Schrift gegen die Hexenverbrennung veröffentlicht. Ich bin in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern waren Geschäftsleute. Sie haben aus eigener Kraft ein Modehaus aufgebaut, das über die Stadt hinaus einen Namen hatte. Rinteln besaß eine Oberschule für Mädchen, die nur bis zur 10. Klasse ging. Bis zum Abitur habe ich dann das Gymnasium für Jungen besucht.
Ab wann wussten Sie, dass Sie Journalistin werden wollen?
Ungefähr mit 17 Jahren. Das Modehaus wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ich war das älteste Kind, hatte allerdings mitbekommen, wie so ein Geschäftshaushalt läuft. Das wollte ich für mich auf keinen Fall. Im Prinzip haben mir meine Eltern bei der Berufswahl freie Hand gelassen. De facto hätten sie aber wohl lieber eine Studienrätin unterstützt als ein Mädchen, das in den Journalismus ging.
Hatten Sie Vorbilder für diesen Weg?
Nein. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, Kinder- und Jugendbücher zu rezensieren. Dass das gedruckt wurde, fand ich fantastisch. In der 12. Klasse wurde die Sache konkreter. Meine Eltern haben gesagt, wenn ich mir ein Praktikum im Journalismus besorge, dann könnten wir über diesen Beruf ernsthaft sprechen. Ich denke, sie haben nicht damit gerechnet, dass das klappt. 1958 habe ich in den großen Ferien ein Praktikum bei der Hannoverschen Presse absolviert, die jetzt Neue Presse heißt. Ich war in der Lokalredaktion Hannover und im Feuilleton. Als letzte Klassenarbeit vor dem Abitur war dann der übliche Aufsatz zum Berufswunsch fällig. Ich habe dort meine Wahl begründet, mit allem, was ich mir angelesen hatte, und mit den Erfahrungen aus dem Praktikum. Das Ergebnis war die einzige Sechs, die ich je bekommen habe. Unleserliche Spinnenschrift, Argumentation nicht nachvollziehbar. So war das in Rinteln.
Haben Sie dort die Auswirkungen des Kriegsendes gespürt?
Vergleichsweise kaum. Wir wurden hin und her geschoben zwischen der Stadt und den Bergen im Umfeld. Oft zogen ganze Trecks in die umliegenden Wälder. Noch heute beunruhigen mich Sirenen, und ich kann mich recht genau an den Luftschutzbunker unter der Sparkasse erinnern. Noch kurz vor Kriegsende wurde die Weserbrücke gesprengt. Vom Hörensagen wusste ich schon als Kind, dass ein deutsches Kommando, das sich in Rinteln verschanzte, zwei amerikanische Emissäre festhielt, die die Übergabe der Stadt verhandeln wollten. Die amerikanischen Streitkräfte drohten ultimativ, die Stadt dem Boden gleichzumachen. Friedrich Wilhelm Ande, der Leiter der Mädchenoberschule, die ich später besuchte, setzte sich für die Freilassung der Emissäre und für die Rettung Rintelns ein. In den letzten Kriegstagen fand man ihn erschossen auf.
Haben Religion und Politik in Ihrem Elternhaus eine Rolle gespielt?
Ja und nein. Die christliche Religion war schlicht und einfach Alltag. Ich wurde ganz selbstverständlich in die Kirche geschickt, und ich durchlief genauso selbstverständlich die verschiedenen Etappen der christlichen Bildung. Aber ein Thema im Sinne Ihrer Frage war das nicht. Was die Politik betrifft, weiß ich nicht einmal genau, wie meine Eltern gewählt haben. Sicher nicht sozialdemokratisch, denn viel später wurde vereinzelt darüber diskutiert, ob es vernünftig sei, als politische Redakteurin für sozialdemokratisch orientierte Zeitungen zu arbeiten.
Der Theologe Helmut Gollwitzer hat geschrieben, dass die Studenten nicht wegen des Studiums an die FU gekommen seien oder wegen der Professoren, sondern wegen der Stadt (Gollwitzer 1976: 481). Warum haben Sie in Berlin studiert?
Wenn Sie den Kontext sehen, in dem ich aufgewachsen bin, dann war das sicher auch ein Ausbruch aus der Enge der Kleinstadt. Ich habe mich sehr für die „großen“ sozialen und politischen Zusammenhänge interessiert. Damals veranstalteten die Oberschulen Pflicht-Besuche in Berlin, meist mit der 12. Klasse. Wir waren damals tagelang in Ost und West unterwegs. Danach wusste ich, dass ich in dieser Stadt studieren will.
Und warum das Hauptfach Publizistik?
Zunächst war das nicht mein Hauptfach. So angepasst war ich schon. Ich wählte Germanistik und auch Anglistik, um später auf zwei Beinen stehen zu können. Alles andere wollte ich gleichsam nebenbei mit abschöpfen. Meine Volontariats-Redaktion hat diese Idee unterstützt: Man sollte sich mit etwas Solidem befassen, hieß es dort. Wer Publizistik studiert, hat in den praktischen Medienberufen keine Chance. In den ersten beiden Semestern hat mich außerdem das große Latinum sehr beschäftigt. Ich ging an die Universität, um irgendwann zu promovieren. Voraussetzung war das Große Latinum. Ich hatte nur das Kleine.
In Berlin gab es in den 1950er-Jahren schon den Magister-Abschluss.
Davon habe ich nichts bemerkt. Oder anders formuliert: Das war für mich überhaupt nicht von Interesse. Dazu war ich zu ehrgeizig. Ich wollte schließlich „irgendetwas“ erreichen. Aber schon im ersten Semester stand alles auf der Kippe. Ich habe unter dem typischen Anfängerfehler auch physisch gelitten. Schauen Sie (zeigt ihr Studienbuch mit einem übervollen Belegplan). Nach diesem ersten Semester kam mit dem Zwang zur Entscheidung die typische Sinnkrise. Was sollte ich auswählen, was konnte entfallen? Zu meiner Ehrenrettung ist allerdings anzumerken, dass die Studiengänge damals längst nicht so strukturiert waren wie heute. Was es gab, war die Regel, zuerst Proseminare und Übungen, danach Mittelseminare und schließlich Oberseminare. Das war’s.
Hier steht auch Theaterwissenschaft.
Das war schrecklich, damals. In Berlin musste man sich natürlich damit beschäftigen, schon wegen der Theaterszene in Ost und West. An der FU haben Hans Knudsen und Wolfgang Baumgart gelehrt. Die Theaterwissenschaft saß in einer alten Villa, wo man unheimlich viel Literatur finden konnte und auch Archivmaterial. Baumgart sagte aber gleich im zweiten oder dritten Satz der Einführungsveranstaltung, wer pro Tag nicht 1000 Seiten lesen könne, brauche mit Theaterwissenschaft gar nicht erst anzufangen. Das war ein Schock. Ich konnte nicht 1000 Seiten pro Tag lesen.
Vielleicht wollte er nur die Studenten abschrecken.
Beim Mädchen aus der Kleinstadt wäre ihm das fast gelungen. Die Freie Universität war überlaufen. Es gab zwar ein generelles Zulassungsverfahren, aber keinen Numerus clausus für einzelne Fächer wie Germanistik, Publizistik oder Theaterwissenschaft. Als Hochschullehrerin habe ich später in Berlin in diesem Zusammenhang etwas ganz anderes erlebt. Gleich in der ersten Seminarveranstaltung hat sich eine Studentin gemeldet und gefragt, ob sie tatsächlich alles lesen solle, was auf meiner Literaturliste steht. Das hat mir die Sprache verschlagen. Die Bochumer Studenten hatten solche Fragen nicht gestellt.
Wer hat Ihr Studium bezahlt?
Meine Eltern. Nach dem Abitur mit einer Auszeichnung fand ich das nur recht und billig. Das Studium war damals allerdings kostspieliger als heute. Wir mussten für jede einzelne Lehrveranstaltung Gebühren zahlen.
In Ihrem Studienbuch steht auch Emil Dovifat.
Seine Vorlesungen fand ich mit einer Ausnahme inhaltlich langweilig. Für Proseminare und Übungen hat er nur gezeichnet, sie aber nicht selbst durchgeführt. Ich habe aber auch ein Seminar bei ihm besucht. Dort wurde rein narrativ und an Beispielen irgendeine journalistische Form behandelt. Ich meine, es war das Feature im Hörfunk. In der Praxis bei der Hannoverschen Presse bzw. Neuen Hannoverschen Presse, wo ich in den Semesterferien mein Volontariat zusammenstückelte, konnte ich damit nichts anfangen. Eine gangbare Brücke zwischen Theorie und Praxis fand ich nicht.
Bisher haben wir fast nur Lob über seine Vorlesungen gehört (vgl. Meyen/Löblich 2007).
Sicher über die „Aktuelle Vorlesung“. Ich habe mir erst in den 1980er-Jahren die Zeit genommen, mich mit Dovifats Gesamtwerk genauer zu beschäftigen. In den frühen Schriften hat mich die Formulierung und Umsetzung einer spezifischen und eigenständigen Fragestellung unseres Fachs angesprochen (vgl. Dovifat 1929). Zu einem ziemlich genau zu bestimmenden Zeitpunkt hat Dovifat diesen Ansatz zugunsten seiner bekannten Arbeiten rund um die sogenannten publizistischen Führungsmittel kommentarlos fallengelassen (vg. Baerns 1998: 260-261). Seine „Aktuelle Vorlesung für Hörer aller Fakultäten“, gebührenfrei und im überfüllten Auditorium Maximum, zeigte und kommentierte das veröffentlichte und das nicht veröffentlichte laufende Geschehen. Das hat mich gefesselt. Das ganze Institut war auf den Beinen und mit den Vorarbeiten beschäftigt gewesen. Ich bewerte die „Aktuelle Vorlesung“ heute als Abglanz jener originären Fragestellungen. Als ich an die Freie Universität zurückgekehrt war, habe ich – ohne größere Resonanz – gemeint, dass man so etwas mit zehn Hochschullehrern doch wieder auf die Beine stellen könnte. Meine eigene Vorlesung „Grundlagen von Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit“ profitierte zweifellos vom Vorbild der „Aktuellen“.
Warum sind Sie als Studentin nicht bei der Germanistik geblieben?
Mir haben die Kriterien gefehlt, mit denen man Literatur beurteilen kann. Objektivierbare Kriterien. Außerdem kam Fritz Eberhard. Ich sehe hier (zeigt auf das Studienbuch), dass ich im Wintersemester 1960/61 bei ihm eine Vorlesung gehört habe. Allgemeine Rundfunklehre. Das war noch nicht besonders beeindruckend. Im Sommersemester ging es dann aber los. Publizistik, allgemeiner Teil. Er hat dort die Publizistikwissenschaft in einem interdisziplinären Zusammenhang verortet und auf sozialwissenschaftliche Grundlagen gestellt.
Wie hat man sich das vorzustellen?
Erstens gab es Einführungen in sozialwissenschaftliche Methoden. Zum Beispiel Umfrageforschung, im Wintersemester 1961/62 von Noelle-Neumann. Zweitens haben sich die Studenten systematisch mit theoretischen Ansätzen und mit empirischen Arbeiten aus den USA auseinandergesetzt. Im Grunde genommen ähnlich wie Gerhard Maletzke (1963). Drittens wurde das neue Wissen angewandt. Ich besuchte beispielsweise im Winter 1961/62 ein Oberseminar bei Eberhard und Fraenkel. „Möglichkeiten der Publizistik zur Festigung der Demokratie“. Dort wurde geprüft, ob Medienberichte in die Argumentation der Parlamentarier eingingen und umgekehrt. Ich habe die Debatte zur Reform des Ehegesetzes untersucht. Was da in unser Fach hineinkam, erlebte ich als neu und anders und so beeindruckend, dass ich den Mut fand, das Hauptfach zu wechseln. Bei Eberhard habe ich dann ja auch promoviert (vgl. Baerns 1968).
Dissertationsthema war eine Zeitschrift in der sowjetischen Besatzungszone. Ihr Kommilitone Dietrich Berwanger hat sich erinnert, dass vor allem die westdeutschen Studenten am Berliner Institut den Forschungsschwerpunkt DDR-Presse langweilig fanden (Berwanger 2001: 20-21).
Da muss ich widersprechen. So pauschal stimmt das nicht. Und dass es nur um die Printmedien ging, ist auch nicht ganz richtig. Ich hatte speziell durch meine Doktorarbeit die Gelegenheit, mich mit offenem Geschehen, hier in der sogenannten antifaschistisch-demokratischen Periode, und mit Problemen der Geschichtsschreibung, die vom erreichten Stand der Entwicklung rückwärts blickt, ohne größeren Zeitdruck grundsätzlicher zu befassen. Ich habe diese Probleme der Medienforschung über die Besatzungszeit unter dem Titel „Deutsch-deutsche Gedächtnislücken“ in meiner Antrittsvorlesung an der Ruhr-Universität Bochum noch einmal aufgegriffen (vgl. Baerns 1988). Das Thema DDR gab es in Berlin schon vor Eberhard. Dovifat hat regelmäßig Lehrveranstaltungen zur „Totalitären Publizistik der SBZ“ angeboten. Das entsprach seinem Wissenschaftsverständnis und dem Standort Berlin.
Und Eberhard?
Er hat sich nie selbst mit dem Thema beschäftigt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter kannten die DDR aber zum Teil aus eigener Anschauung. Peter Heilmann hat beispielsweise in einem Proseminar die publizistischen Führungsmittel durchdekliniert. Ich hatte mir die Musik ausgesucht und in der Literatur der Bundesrepublik nichts dazu gefunden. Wohl aber in der DDR. Dort war zwar nicht vom „publizistischen Führungsmittel“ die Rede, aber was über die Funktion der Musik beim Aufbau des Sozialismus propagiert wurde, das schien genau zu passen. Und dann gab es die Seminare und Diskussionen mit Elisabeth Löckenhoff. Dort wurde nicht nur die amtliche Formulierung „SBZ“ infrage gestellt. Wir wurden auch angeregt, Bundesrepublik und DDR auf dem gleichen Niveau zu untersuchen und nicht mehr einfach die Normen der Bundesrepublik auf den Journalismus in der DDR anzuwenden.
Eine systemimmanente Analyse.
Peter Christian Ludz hat damit rund zehn Jahre später öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung gefunden.
Wurde in den Seminaren von Löckenhoff auch empirisch gearbeitet?
Meist inhaltsanalytisch. Wir waren auf schriftliches Material angewiesen, von Grundlagentexten und Untersuchungen aus Leipzig über Protokolle, Beschlüsse, Gesetze und Fachzeitschriften bis hin zu den Inhalten der allgemeinen Medien. Die Abhängigkeit von der Datenlage war die Achillesferse der systematischen Beschäftigung mit der DDR.
Hatten Sie Verwandte im Osten?
Nein. Ich hatte nach einem Schüleraustausch in den 1950er-Jahren einen einzigen direkten Kontakt, zuerst nach Dresden und später nach Ostberlin.
Jan Tonnemacher (2001: 26-27) meint, dass Fritz Eberhard am Anfang etwas blass gewesen wäre im Vergleich mit dem Rhetoriker Dovifat, dass er dann aber sympathischer geworden sei, vor allen Dingen durch die Werbearbeit von Elisabeth Löckenhoff.
Für mich war Eberhard von Anfang an farbig genug. Widerstand und Emigration im Dritten Reich, Mitarbeit im Parlamentarischen Rat, widerspenstiges SPD-Mitglied, Atheist. Allerdings hat mich gestört, wie er Elisabeth Löckenhoff für seine Arbeit einspannte. Halb wohlwollend, halb Besitz ergreifend nannte er sie in der Regel seine „Rätin“. Sie hat die Verwaltungsarbeit übernommen, sie hat seine Lehrveranstaltungen strukturiert, sie hat an Publikationen und Vorträgen mitgearbeitet, sie hat die Doktoranden betreut. Für mich hat Eberhard nach der mündlichen Prüfung zwar auf irgendeinen Sonderdruck „Für meine erste Doktorandin“ geschrieben. Und ich war stolz darauf. Aber betreut worden ist meine Doktorarbeit nicht von ihm. Elisabeth Löckenhoff hat am Berliner Institut in dieser Zeit eine im Wortsinn tragende Rolle gespielt. Sie ist nicht angemessen gewürdigt worden. Auch nicht durch das Bändchen, das Rolf Geserick und Arnulf Kutsch (1988) zwei Jahre nach ihrem Tode herausgegeben haben.
Von wem haben Sie mehr gelernt: von Dovifat, Eberhard oder Löckenhoff?
Ist das nicht deutlich geworden? Mir ist erstens Löckenhoffs konstruktive Kritik, zweitens Eberhards Verständnis der Publizistikwissenschaft als Sozialwissenschaft und drittens die Auseinandersetzung mit Dovifat zu Gute gekommen, dies allerdings erst nach meinem Studium. Einer „Schule“ werden Sie mich nicht zuordnen können.
Weshalb haben Sie sich auch in Bochum weiter mit dem Thema DDR beschäftigt?
Dort gab es auf diesem Gebiet profilierte Wissenschaftler. Oskar Anweiler, Paul Gerhard Klussmann, Dieter Voigt, Wilhelm Bleek. Wir taten uns in einem interdisziplinären Arbeitskreis für DDR- und vergleichende Deutschlandforschung zusammen. Am Beginn standen gemeinsame Ringvorlesungen, die wir dokumentiert haben. Aus diesen Aktivitäten ging Mitte 1989 das Institut für Deutschlandforschung als Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der Ruhr-Universität hervor. Als Korrespondierendes Mitglied war ich weiter beteiligt, bis die politische Entwicklung das Projekt fürs Erste ad absurdum führte.
Was haben die Bochumer Studenten zur DDR-Forschung gesagt?
Sie haben von den gemeinsamen Veranstaltungen profitiert und hatten nach dem Kulturabkommen die Möglichkeit zu Exkursionen. An die Humboldt-Universität in Ostberlin, an die Karl-Marx-Universität in Leipzig. Für mich als Dozentin hatten die DDR-Themen noch einen ganz anderen Vorteil. Ich konnte hier „normale“ Seminare mit höchstens 15 Teilnehmern veranstalten. Daraus sind bezeichnenderweise viele Magisterarbeiten und Dissertationen hervorgegangen.
Haben Sie in Berlin noch die Studentenbewegung erlebt?
Am Rande. Ich hatte mich Anfang 1965 beurlauben lassen mit der Begründung, ich müsse die Doktorarbeit schreiben. Im Mai 1965 habe ich geheiratet. Immer noch unpromoviert. Erst im Juni 1967 stand mein Rigorosum an. Kurz zuvor war Benno Ohnesorg erschossen worden. An der Demonstration danach habe ich teilgenommen. Ich war keine Anhängerin des SDS. Auch die Enteignet-Springer-Aktionen fand ich unangemessen. Der Baukasten von Enzensberger hat mir später geholfen, mein Unbehagen zu formulieren. Er hat dort geschrieben, dass der Manipulationsvorwurf gegen Springer falsch sei, weil Manipulation auf Deutsch Hand- oder Kunstgriff heiße und folglich jeder Gebrauch der Medien Manipulation voraussetze (vgl. Enzensberger 1970: 106), und er hat nach anderen Lösungen gesucht.
Darf man Sie fragen, ob Sie in einer Partei Mitglied waren oder sind?
Ich war auch zur Zeit Willy Brandts nicht in der SPD. Diese Entscheidung stand schon während des ersten Redaktionspraktikums an. Wir haben darüber diskutiert, ob man als Journalist Parteimitglied sein kann. Die Hannoversche Presse war eine sozialdemokratische Zeitung, und einige Redakteure waren in der SPD, wenn auch nicht alle. Ich wollte nie den Interessen Dritter zuarbeiten. Dieser Gedanke hat mich bis in die Gegenwart getragen – und verfolgt.
In den Interviews, die wir bisher geführt haben, hat uns überrascht, welche Rolle viele Kollegen der Parteipolitik in den Berufungsverfahren zugeschrieben haben (vgl. Meyen/Löblich 2007).
Ich sollte mich stattdessen für geschlechtsspezifische Selektionskriterien interessieren, obwohl ich aus einem Milieu stamme, in dem es hieß, „durch Leistung kannst Du alles erreichen“. Wo ich aufgewachsen bin, haben Mann und Frau gleichberechtigt zusammengearbeitet, und bis zum Abitur habe ich mir über die Benachteiligung von Frauen überhaupt keine Gedanken gemacht. Jetzt vor dem Interview habe ich mir noch einmal die Zeugnisse angeschaut, die ich beispielsweise als politische Redakteurin bekommen habe. Dort wird in schöner Regelmäßigkeit erwähnt, dass ich mich in einer männlich besetzten Redaktion durchgesetzt und trotzdem ausgeprägten Teamgeist gezeigt hätte. Mir schien das damals gar nicht erwähnenswert. Im Wettbewerb um eine Professorenstelle außerhalb der Ruhr-Universität Bochum hielten diese Eigenschaften oder Fähigkeiten einschließlich Praxiserfahrung und Habilitation den Anforderungen offensichtlich nicht ohne Weiteres stand. Ich mag mich gar nicht daran erinnern, dass ich neunmal „gesungen“ habe, bevor „es klappte“. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich bis heute nicht durchschaut, welche Vorzüge die männlichen Bewerber, die tatsächlich berufen wurden, auszeichneten.
Hätten Sie sich Ende der 1960er-Jahre vorstellen können, einmal an einer Universität zum Thema Öffentlichkeitsarbeit zu forschen und zu lehren?
Nein. Zur Öffentlichkeitsarbeit bin ich unfreiwillig gekommen. Wieder so eine (altmodische?) Frauengeschichte. Bis 1971 arbeitete ich bei der Neuen Hannoverschen Presse und war dort glücklich. Aber ich war verheiratet. Mein Mann hat sich im Fach Technische Chemie habilitiert und ist anschließend erst einmal in die Praxis gegangen. Das ist in diesem Fach üblich, bevor man die Chance hat, einen Ruf an die Hochschule zu bekommen. Er ging zu Krupp nach Essen, und unsere Familien drängelten. Es war völlig undenkbar, dass Eheleute ihren Beruf an verschiedenen Orten ausübten. Ich habe nach langem Hin und Her schließlich in Hannover gekündigt, bin ihm nachgezogen und habe mangels Redakteursstelle in der Öffentlichkeitsarbeit der Coca-Cola GmbH angefangen. Für eine Journalistin war „die andere Seite“ damals leicht degoutant. Obwohl mir dort schnell eine Abteilungsleitung angeboten worden war, habe ich nach zwei Jahren gekündigt, bin zunächst nach Hannover zurückgekehrt und dann in die Politikredaktion der Neuen Ruhr Zeitung gewechselt. Sozialem Druck kann ich seitdem ganz gut standhalten. Jedenfalls denke ich das.
Haben Sie die Jahre bei Coca Cola bereut?
Ich habe beispielsweise die Olympischen Spiele in München vor Ort erlebt. Das war schon etwas. Darüber hinaus habe ich viel über Journalismus gelernt. Mehr als ich wollte. Als Journalistin war ich auf Aktualität programmiert. Ein absoluter Maßstab. In der Öffentlichkeitsarbeit habe ich gesehen, wie einfach man Aktualität schaffen kann. Was ich dort über die Steuerungsmöglichkeiten von Medien beobachten konnte, hat mich motiviert, an die Universität zurückzugehen, um die Problematik genauer zu bearbeiten.
Kann man Ihre Habilitationsschrift als Summe der Erfahrungen beschreiben, die Sie in beiden Bereichen gesammelt haben, im Journalismus und in der PR (vgl. Baerns 1985)?
Diese Formulierung trifft es nicht ganz. Ich hatte eine, wie ich nach wie vor meine, gesellschaftlich wichtige und praxisrelevante Fragestellung, die mit den Mitteln der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft zu bearbeiten war. Die dort vorherrschenden Denkmodelle und medienzentrierten Betrachtungsweisen entpuppten sich allerdings auch unter methodologischen Gesichtspunkten als Herausforderungen für eine ergebnisoffene Studie, die beabsichtigte, den relativen Einfluss von Öffentlichkeitsarbeit beim Entstehen und Zustandekommen von Medieninhalten zu entfalten. Untersuchen konnte man dies nur im politischen Raum, weil unsere Kommunikationsverfassung in diesem Bereich recherchierenden Journalismus voraussetzt und besonders absichert. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat einen entsprechenden Forschungsantrag gebilligt und die recht aufwendigen Untersuchungen des nordrhein-westfälischen Mediensystems finanziert. Die Studie fand zwar auch im Journalismus und in der Öffentlichkeitsarbeit Resonanz, aber umfangreicher in der Wissenschaft. Sie ist oft zitiert und weniger häufig gelesen worden, und sie regte in deutschsprachigen Universitäten eine Fülle von Magisterarbeiten, auch Dissertationen, an.
Wo haben Sie die Öffentlichkeitsarbeit später im Fach verortet?
Auch in der DPRG diskutierte man damals darüber, wie das Fach Public Relations an der Universität zu verankern sei. Es gab einen Arbeitskreis „Public Relations in Forschung und Lehre an der Universität“ um Heinz Flieger und Franz Ronneberger, die sich eine Art Universaldisziplin vorstellten, in die Inhalte aus der Politikwissenschaft, aus der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, aus der Soziologie, aus der Sozialpsychologie, aus der Philosophie, aus der Linguistik, aus den Wirtschaftswissenschaften und aus den Rechtswissenschaften einflossen (vgl. Flieger 1981: 11-45). Mein Konzept war anders. Ich wollte Public Relations unter dem Dach der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft verankern. In Fliegers Bändchen zum Public-Relations-Studium an Universitäten habe ich die „Bochumer Position“ sinngemäß so klargestellt: Die Wissensbestände und Erkenntnisse der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft können anwendungsorientiert den einzelnen Tätigkeitsfeldern dienen: erstens Journalismus, zweitens Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations, drittens Medienpädagogik. Schwerpunktbildungen im Hinblick auf die genannten Tätigkeitsfelder sind möglich, ohne den Fachzusammenhang aufzulösen. Denn ein und dieselben Wissensbestände und Erkenntnisse lassen sich auf unterschiedliche Funktionen hin interpretieren und umsetzen (vgl. ebd.: 48). In der englischen Version des Bandes, die im gleichen Jahr im gleichen Verlag erschien, fehlen diese Ausführungen zwar, aber das Bochumer PR-Studium und – ausgefeilter – der Studienschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit in Berlin standen auf dieser Grundlage. Die Bochumer Magisterordnung hatte zudem einen für unser Fach nicht zu unterschätzenden Vorteil: An der Ruhr-Universität war das Hauptfach Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit allen anderen Hauptfächern, die an der Universität vertreten waren, als Zwei-Fach-Studium im Magisterstudiengang kombinierbar. Diese Möglichkeit bestand nur dort.
Wie ist es zu der Mitarbeiterstelle in Bochum gekommen?
Ich hatte von Essen aus Kontakt zum Berliner Institut gesucht, ohne auf Interesse zu stoßen. In Bochum habe ich mich gar nicht mehr um eine Stelle bemüht, sondern nur um einen Lehrauftrag als Praktikerin. Offenbar gab es aber schon genug Lehrbeauftragte. Heinz-Dietrich Fischer hat sich wenigstens meinen Namen und meine Adresse notiert. Als dort ein halbes Jahr später eine Rats-Stelle ausgeschrieben wurde, bin ich gefragt worden, ob ich mich bewerben wollte. Das habe ich sofort getan. Ich erhielt die Stelle, habe das DFG-Projekt und die Habilitation durchgezogen und gleichzeitig zwölf Stunden Lehre angeboten und durchgeführt.
Petra Dorsch-Jungsberger (2004: 233) hat gesagt, dass es Mitte der 1970er-Jahre für eine verheiratete Frau mit Kind nicht einfach gewesen sei, eine Dauerstelle an einer Universität zu bekommen.
Kinder habe ich mir nicht zugetraut.
Haben Sie das als Verzicht empfunden?
Ich habe viel Zeit in meinen Beruf investiert. Möglicherweise zu viel. Ärgerlich war manche Diskussion mit meinem Mann, der in der akademischen Laufbahn immer ein paar Etappen Vorsprung hatte und dann nicht mehr nachvollziehen konnte, was mich bewegte. In den letzten Wehen der Habilitationsschrift habe ich zum Beispiel einen Segeltörn im Mittelmeer abgesagt. Die Folge war eine Flaute in der persönlichen Beziehung.
Wie haben Sie in Bochum den Aufstieg von der Mitarbeiterin zur Professorin erlebt?
Als normal. In Nordrhein-Westfalen war es möglich, Akademische Oberräte mit Habilitation auf eine C2-Professur zu überführen. In der Hochschulöffentlichkeit war das zwar umstritten, aber ich fand in Ordnung, dass ich die Professur bekam. Ich hatte viel gearbeitet, ich konnte Studenten gut in unsere Disziplin einführen, und ich hatte etwas zu sagen.
Kurt Koszyk (1997: 247) hat berichtet, dass es an der Ruhr-Universität starke Widerstände gegen das Fach gegeben habe.
Ich habe mich in Bochum wohl gefühlt. Joachim H. Knoll hat mein Habilitationsverfahren als Dekan außergewöhnlich aufgeschlossen und umsichtig begleitet. In einer Lehrveranstaltung mit Jörn Rüsen, in der es um Geschichte als Geschichten in den Massenmedien ging, habe ich wahrscheinlich mehr gelernt als alle Studenten zusammen. Parallel liefen die interdisziplinäre DDR-Forschung und der Versuch, eine Plattform für die publizistik- und kommunikationswissenschaftliche Aus- und Weiterbildung für PR zu schaffen. Das alles hat Dynamik entwickelt. Wir mussten allerdings um jeden Pfennig und um jede studentische Hilfskraft kämpfen, obwohl das Fach immer mehr Studenten anzog. Das könnte Koszyk gemeint haben. Das war anstrengend, aber ich habe diese Auseinandersetzungen nicht als unnormal empfunden. Mein Wechsel nach Berlin hatte allerdings nicht unwesentlich damit zu tun, dass mir der Rektor nicht einmal eine halbe Mitarbeiterstelle zubilligen wollte. Ich erinnere mich gut an das letzte Telefongespräch, das den Ausschlag gab: Der Rektor glaubte nicht, dass ich gehen würde. Er meinte, ich bluffe. In Bochum arbeitete ja mein Mann … Ich kann übrigens ergänzen, dass nach Jahren mein Mann nachgezogen ist nach Berlin.
War Mainz für Sie eine Option? Im Winter 1985/86 waren Sie ja schon dort.
Ich wurde gefragt, ob ich für ein Semester die vakante Noelle-Neumann-Stelle vertreten wolle. Basis war sicher die Habilitationsschrift. Damals wäre ich gern in Mainz geblieben.
Berlin klang gerade nicht wie Ihre Traumstadt.
Der Ruf kam im Frühjahr 1989, und die Entscheidung fiel im Herbst. Am 29. September wurde ich ernannt. Aus westdeutscher Perspektive lag Berlin in dieser Zeit nicht gerade im Zentrum des Geschehens. Wenn mir heute jemand sagt, er habe die Wiedervereinigung „schon immer“ vorausgesehen, dann erzähle ich, wie mein Abend des 9. November 1989 ablief. Ich bin im Taxi zum Flughafen gefahren, um das Wochenende in Bochum zu verbringen. Irgendwann auf der Strecke zwischen Lankwitz und Tegel sagte jemand über Funk zum Fahrer: Die Mauer soll offen sein. Was hältst Du davon? Die Taxi-Insassen waren sich einig, dass das ein Witz ist. Das konnte gar nicht sein. Ich bin weiter gefahren und habe die Maueröffnung zu Hause vor dem Fernseher erlebt anstatt vor Ort.
Wie würden Sie die Arbeit in Berlin mit der Arbeit in Bochum vergleichen?
Das Fach war an beiden Universitäten überlaufen. Als Hochschullehrer wird man voll beansprucht durch Administration, durch Mittelbeschaffung, durch das Betreuen von Abschlussarbeiten. Das scheint an unserer Disziplin zu liegen. In Berlin habe ich mir sehr viel Mühe gegeben mit der Lehre, und das nicht nur, weil ich jetzt dort Vorlesungen halten konnte, wo ich früher selbst als Studentin gesessen hatte. In die Vorlesung „Grundlagen des Journalismus und der Öffentlichkeitsarbeit“ sind auch viele Zuhörer aus anderen Fächern gekommen. In Bochum habe ich außerdem nie gesehen, dass Hochschullehrer nicht nur Kollegen sind, sondern auch Konkurrenten. In Berlin war das Szenario anders.
Welche Position hatten Sie dort als Praktikerin und PR-Forscherin?
In Berlin bin ich in ein Kollegium gekommen, das nur aus ehrgeizigen Menschen bestand. Jeder hat das, was er realisiert hat, für ganz besonders wichtig gehalten. Ich auch. Ich habe außerdem gesagt, dass man als Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler in der Praxis gearbeitet haben muss und habilitiert sein soll. Damit habe ich einige Kollegen beleidigt. Außer mir hatte in Berlin niemand diese Kombination. Ich denke außerdem, dass Publizistik- und Kommunikationswissenschaft einen gesellschaftlichen Nutzwert besitzt. Daraus ergibt sich die Anwendungsorientierung. Auch hier unterscheide ich mich von vielen Kollegen.
Angewandte Forschung kann auch Probleme mit sich bringen.
Speziell im Bereich Öffentlichkeitsarbeit muss man aus meiner Sicht darauf achten, nicht von Einzelinteressen vereinnahmt zu werden. Das trifft nicht nur für die Forschung zu, sondern auch für die Lehre. Deshalb habe ich vier programmatische Punkte zu den Chancen und Risiken des Studienschwerpunkts Öffentlichkeitsarbeit formuliert, die für meine Arbeit wichtig waren und sind:
- Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations gilt als das Management von Kommunikationsprozessen für Organisationen mit deren Bezugsgruppen. Auf dieser Grundlage ist Öffentlichkeitsarbeit ein Prozess – kein Maßnahmenbündel. Dieser Prozess wird gemanagt, also geplant, kontrolliert, bewertet und so gestaltet.
- Die Fragestellungen der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sind kompatibel. Denn das besondere Interesse gilt der Entfaltung und Kontrolle erstens publizistischer Prozesse, meist Informationsprozesse via Massenmedien, zweitens – auch nichtöffentlicher – medienvermittelter Prozesse, drittens zwischenmenschlicher Kommunikation und schließlich der Entfaltung und Kontrolle ihrer Vernetzungen. Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft versucht aus verschiedenartigen theoretischen Perspektiven und mit allen denkbaren (historisch-hermeneutischen und/oder empirisch-analytischen) Methoden und Verfahren Regelmäßigkeiten oder Besonderheiten dieser Prozesse zu ermitteln und zu erfassen.
- Wenn auf der einen Seite gemanagt, auf der anderen Seite durchschaut werden soll, dann liegt doch folgende Schlussfolgerung auf der Hand: Kommunikationsprozesse zu durchschauen und zu gestalten, das ist ein gemeinsames Projekt der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und der Öffentlichkeitsarbeit.
- Das gemeinsame Projekt macht weder Öffentlichkeitsarbeit zu einem Objekt kritischer Weltverbesserungsattitüden, noch setzt es eine Wissenschaft voraus, die sich anbiedert. Die Zusammenarbeit ist dennoch von hohem Nutzen für beide Seiten. Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, einerseits, braucht den unmittelbaren Zugang zu den Prozessen, die untersucht und verstanden werden sollen. Für Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations, andererseits, erscheint es plausibel, die beabsichtigten Kommunikationsprozesse auf der Grundlage systematischer Erforschung zu optimieren, das heißt, Forschungsergebnisse anzuwenden. Professionelles Handeln erschöpft sich jedoch nicht in strategischem Handeln. Es vermag seinen Kontext und seine Folgen zu durchschauen. Es ist damit zugleich verantwortliches Handeln, nicht, weil es aus einer entsprechenden Gesinnung hervorgeht, sondern weil es die Wirkungen, die es wahrscheinlich erzeugen wird, mitbedenkt, antizipiert und einkalkuliert (Baerns 1995a: 5-6).
Haben Sie je darüber nachgedacht, wieder in die Praxis zu gehen?
Nein. Nach der Abschiedsveranstaltung im Februar 2004 hat mir jemand sogar ein ambivalentes Verhältnis zur Praxis unterstellt. Das ist vielleicht nicht ganz unrichtig. Es ging bei dieser Veranstaltung um die Frage der Festschrift Quo vadis Public Relations? (vgl. Raupp/Klewes 2004). Ich habe auf der Grundlage unserer empirischen Forschungsergebnisse ausgeführt, dass es der Öffentlichkeitsarbeit immer noch nicht gelungen ist, sich von anderen Berufen abzugrenzen, vor allem nicht vom Journalismus und von der Werbung. Auch im Bereich des professionellen Kommunikationsmanagements hat es keine sichtbaren Fortschritte gegeben. Das Problem der Professionalisierung wird mich jedenfalls weiter beschäftigten (vgl. Baerns/Labatzke 2006).
Den Ruf auf den ersten Lehrstuhl für Public Relations in Deutschland haben Sie abgelehnt.
Dass es in Leipzig gelungen ist, eine C4-Stelle einzurichten, habe ich als logische Folge der Entwicklung gesehen, für die ich gearbeitet habe. Ich war Mitglied der Leipziger Gründungskommission, hätte mich aber allein mit dieser Forderung nicht durchsetzen können, wahrscheinlich schon wegen der Anwendungsorientierung, für die ich plädiert habe. Der letzte Anstoß soll dann von Winfried Schulz gekommen sein. Dass ich den Ruf auf diesen Lehrstuhl bekommen habe, fand ich angemessen. Ich hatte die fachlichen Voraussetzungen und war an den historischen Erfahrungen der beiden deutschen Staaten interessiert.
Warum haben Sie den Ruf abgelehnt?
Ich habe ausführlich verhandelt. Ich wollte den Studiengang „European Master’s Degree in Public Relations (Communication Management)“ nach Leipzig mitnehmen. Dieses Projekt wurde in den ersten Jahren aus Erasmus-Mitteln finanziert und setzte das Studium der Öffentlichkeitsarbeit in mindestens zwei europäischen Ländern voraus. Das Ministerium wollte für diesen Studiengang keine zusätzliche Stelle locker machen. Ich denke, Karl Friedrich Reimers vertrat ebenfalls die Meinung, dass die „Wessis“ Geld mitbringen sollten und keine Ansprüche. Kurz und gut: In Berlin war die Ausstattung ungleich besser. Dort hatte ich eine ganze Sekretariatsstelle, zwei Mitarbeiterstellen und zusätzliche Mittel. In Leipzig gab es eine halbe Sekretariatsstelle, eine einzige Mitarbeiterstelle und die Idee, sogar für die Lehre Drittmittel zu beschaffen.
Warum gibt es im deutschsprachigen Raum nicht längst mehr Lehrstühle für PR?
Unter anderer Bezeichnung sind doch an Universitäten und Fachhochschulen eine ganze Reihe von Professorenstellen entstanden. Speziell in Berlin wurde ein neues Konzept entwickelt, kurz bevor ich ausgeschieden bin. Dort waren die C4-Stellen in den sogenannten grundständigen Bereichen als Eckprofessuren angesiedelt. Dass für die Anwendungsbereiche nur C3-Stellen vorgesehen waren, ist unter Berücksichtung pragmatischer Erwägungen zwar nachvollziehbar. Aber im Grundsatz halte ich derartige Entscheidungen nicht für vertretbar, weil Integration beides einfordert, praktische sowie publizistik- und kommunikationswissenschaftliche Erfahrungen und Kenntnisse. Sie setzt so doppelte Kompetenz voraus.
Die Berliner Studierenden klagen bis heute immer wieder über die Bedingungen: schlechte Räume, fehlendes Personal, chronische Überlastung. Warum nimmt das Chaos am Berliner Institut kein Ende?
Zur Gegenwart will ich mich nicht äußern, weil mir der exakte Einblick fehlt. „Zu meiner Zeit“ haben weder das Institut noch die Universität die Schwierigkeiten geschaffen, sondern das Land Berlin. Nach der Wende wäre es vorstellbar gewesen, Freie Universität und Humboldt-Universität zusammenzuführen. Eine Gesamtberliner Strukturkommission hat anders entschieden. Der Senat hat infolgedessen in den 1990er-Jahren nach und nach die Hälfte des FU-Etats auf die Humboldt-Universität verlagert. Damals fingen die Streichungen an, während die hohen Studentenzahlen blieben. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Altersbezüge der Hochschullehrer die Etats der Hochschulen zusätzlich belasten. An den Westberliner Universitäten war meine Generation stark vertreten. Das sind Hochschullehrer, die in den letzten Jahren ausgeschieden sind. Weil kein Geld da war, wurden viele Stellen nicht wiederbesetzt. Die Humboldt-Universität ist davon weniger betroffen, weil sie eine andere Altersstruktur besitzt.
War die Berliner Professur die Position, auf der Barbara Baerns ihre Fähigkeiten und die Erfahrungen, die sie in einem langen Berufsleben gesammelt hat, am besten einbringen konnte?
Was sollen Spekulationen? Das war nun einmal so.
Gibt es Kollegen, zu denen Sie eine besondere Verbindung haben oder hatten?
Von einem Netzwerk kann man wohl im europäischen Kontext sprechen. Wenn eine Kooperation nötig war, habe ich ansonsten einfach versucht, den Kontakt herzustellen, und dabei keine Rücksicht darauf genommen, ob ich jemanden persönlich kannte oder nicht. An der FU waren die Diskussionen mit Axel Zerdick wichtig, auch über hochschulpolitische Entscheidungen und Maßnahmen. Und natürlich hatte ich eine besondere Verbindung zu Journalistikwissenschaftlern wie Stephan Ruß-Mohl. Es bestand aber auch eine „besondere“ Beziehung zu Kollegen, die, was andere aufbauten, gern wieder einrissen. Nach meinem Ausscheiden wurde beispielsweise der europäische Studiengang, über den wir gerade gesprochen haben, eingestellt und schließlich wieder abgeschafft.
Gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind?
Nein.
Und umgekehrt: Würden Sie heute etwas anders machen?
Nicht im Bereich unseres Gesprächsthemas.
Was bleibt von Barbara Baerns in der Kommunikationswissenschaft? Was sollte bleiben, wenn Sie darauf Einfluss hätten?
Ich denke, ich laufe offene Türen ein, wenn ich wünsche, dass die Transparenz publizistischer Prozesse und der Untersuchungsgegenstand, den wir hier als Öffentlichkeitsarbeit bezeichnet haben, auf der wissenschaftlichen Tagesordnung bleiben. Daneben wird sich die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft darauf einlassen müssen, die systematische Umsetzung und den Transfer ihrer Erkenntnisse in den Journalismus, in die Öffentlichkeitsarbeit und auch in die Medienpädagogik weitergehend selbst zu organisieren und zu verantworten. Aus fachlichem Interesse – und weil die Zivilgesellschaft darauf einen Anspruch hat.
Literaturangaben
- Barbara Baerns: Ost und West. Eine Zeitschrift zwischen den Fronten. Münster: Fahle 1968.
- Barbara Baerns: Öffentlichkeitsarbeit oder Journalismus? Zum Einfluss im Mediensystem. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik 1985.
- Barbara Baerns: Deutsch-deutsche Gedächtnislücken: Zur Medienforschung über die Besatzungszeit. In: Rolf Geserick/Arnulf Kutsch (Hrsg.): Publizistik und Journalismus in der DDR. Acht Beiträge zum Gedenken an Elisabeth Löckenhoff. München: Saur 1988, S. 61-114.
- Barbara Baerns: Kommunikationsprozesse durchschauen und gestalten. Ein gemeinsames Projekt der Kommunikationswissenschaft und der Öffentlichkeitsarbeit. In: Public Relations Forum für Wissenschaft und Praxis 1. Jg. (1995), S. 5-7.
- Barbara Baerns: „Wahrheit Wahrheit und Lüge Lüge nennen können.“ Öffentliche Informationsleistungen als Thema der Zeitungs- und Publizistikwissenschaft Emil Dovifats. Rekonstruktionsversuch und Kritik. In: Bernd Sösemann (in Zusammenarbeit mit Gunda Stöber) (Hrsg.): Emil Dovifat – Studien und Dokumente zu Leben und Werk. Berlin: de Gruyter 1998, S. 229-265.
- Barbara Baerns/Kerstin Labatzke: Zum heuristischen Wert des Encroachment-Modells für PR-Forschung und Öffentlichkeitsarbeit – Rekonstruktion und Kritik. In: Karin Pühringer/Sarah Zielmann (Hrsg.): Vom Wissen und Nicht-Wissen einer Wissenschaft. Kommunikationswissenschaftliche Domänen, Darstellungen und Defizite. Berlin: Lit 2006, S. 51-71.
- Dietrich Berwanger: Die Ankunft am Berliner Institut. In: Bernd Sösemann (Hrsg.): Fritz Eberhard. Rückblicke auf Biographie und Werk. Stuttgart: Steiner 2001, S. 19-23.
- Petra Dorsch-Jungsberger: Ich bin mit dem Konflikt sozialisiert worden. In: Michael Meyen/Maria Löblich (Hrsg.): 80 Jahre Zeitungs- und Kommunikationswissenschaft in München. Bausteine zu einer Institutsgeschichte. Köln: Herbert von Halem 2004, S. 231-235.
- Emil Dovifat: Wege und Ziele der Zeitungswissenschaftlichen Arbeit. Berlin, Leipzig: de Gruyter 1929.
- Hans Magnus Enzensberger: Baukasten zu einer Theorie der Medien. In: Kursbuch 20, März 1970, S. 159-186.
- Heinz Flieger (Hrsg.): Public Relations Studium an Universitäten. Vorschläge des DPRG-Arbeitskreises PR-Lehre und -Forschung an Universitäten. Düsseldorf: Verlag für Wirtschaftsbiographien 1981
- Rolf Geserick/Arnulf Kutsch (Hrsg.): Publizistik und Journalismus in der DDR. Acht Beiträge zum Gedenken an Elisabeth Löckenhoff. München: Saur 1988.
- Helmut Gollwitzer: Ein Go-Out der Professoren. In: Manfred Kötterheinrich/Ulrich Neveling/Ulrich Pätzold/Hendrik Schmidt (Hrsg.): Rundfunkpolitische Kontroversen. Zum 80. Geburtstag von Fritz Eberhard. Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt 1976, S. 479-486.
- Kurt Koszyk: Wie man Kommunikationshistoriker wird. In: Arnulf Kutsch/Horst Pöttker (Hrsg.): Kommunikationswissenschaft – autobiographisch. Zur Entwicklung einer Wissenschaft in Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 243-250.
- Gerhard Maletzke: Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik. Hamburg: Hans-Bredow-Institut 1963.
- Michael Meyen/Maria Löblich (Hrsg.): „Ich habe dieses Fach erfunden“. Wie die Kommunikationswissenschaft an die deutschsprachigen Universitäten kam. 19 biografische Interviews. Köln: Herbert von Halem 2007.
- Juliana Raupp/Joachim Klewes (Hrsg.): Quo vadis Public Relations? Auf dem Weg zum Kommunikationsmanagement: Bestandsaufnahmen und Entwicklungen. Wiesbaden: VS Verlag 2004.
- Jan Tonnemacher: „Beim Rundfunk ist man eben pünktlich”. Fritz Eberhard als akademischer Lehrer. In: Bernd Sösemann (Hrsg.): Fritz Eberhard. Rückblicke auf Biographie und Werk. Stuttgart: Franz Steiner 2001, S. 26-27.
Empfohlene Zitierweise
- Barbara Baerns: Eine Brücke schaffen zwischen Theorie und Praxis. In: Michael Meyen/Thomas Wiedemann (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft. Köln: Herbert von Halem 2014. http://blexkom.halemverlag.de/bruecke/ (Datum des Zugriffs).